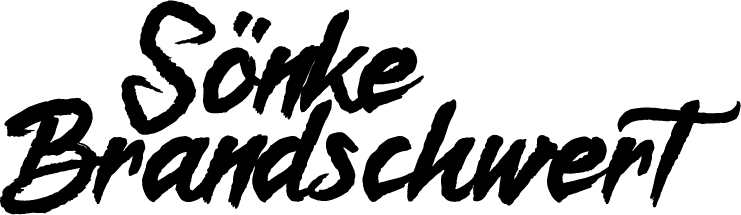Leseproben
Ich möchte Sie herzlichst einladen sich einen ersten Eindruck meiner Bücher zu machen. Dafür stelle ich Ihnen folgende Leseproben zur Verfügung:
Töte, um zu leben (2014, ISBN 978-3-9427250-3-3)
Sämtliche Abläufe führte der Fremde mit einer solchen Selbstverständlichkeit und Ruhe aus, dass es Edwin fast beiläufig vorkam, wie er niedergestochen wurde.Es war vollkommen anders, als er es erwartet hätte. Der Schmerz war gar nicht so groß, als sich der kalte Stahl in seine Gedärme bohrte. Viel größer als die Pein war der Schock darüber, dass jemand gerade dabei war, ihn umzubringen.
Sein eigenes Gesicht spiegelte sich in der futuristischen Brille des Fremden wieder, und Edwin erkannte den Glanz seiner feuchten Stirn.
Schon glitt die Klinge wieder aus seinem Körper heraus, und er spürte, wie die Haut um die Wunde herum warm wurde. Gleichzeitig nahm er den Geruch wahr. Den Geruch von Blut. So stark und eindeutig, wie er ihn nie zuvor gerochen hatte. Dabei hätte er früher niemals den Geruch von Blut beschreiben können. Er hätte nicht einmal sagen können, ob Blut überhaupt roch.
Beim Hinuntersehen erkannte er den roten Fleck, der sich schnell auf seinem weißen Hemd ausbreitete. Dann drang die Klinge erneut in seinen Körper ein, diesmal in der Herzgegend. Als ob der Fremde genau wusste, an welchen Stellen sich Edwins Rippen befanden, bewegte sich das Metall genau zwischen zweien hindurch. Dieser Stich war schmerzvoller als der erste. Viel schmerzvoller.
‚Du musst etwas von ihm erwischen, damit sie eine Spur haben‘, schoss es Edwin durch den Kopf. Ihm war bewusst, dass er keine Minute mehr zu leben hatte. Um die letzten Sekunden seines Lebens so intensiv wie nur irgend möglich auszukosten, erlebte Edwin sie mit einer fantastischen Klarheit. Das in enormen Dosen ausgeschüttete Adrenalin konnte ihn zwar nicht retten, aber immerhin sein Gehirn zu einer letzten Höchstleistung bewegen. In einer reflexartigen Bewegung griff er nach dem Schal des Fremden und ballte seine Faust um den Stoff.
Der Fremde ließ es widerstandslos geschehen, als Edwin an dem Kleidungsstück riss. Er spürte, wie das Tuch zwischen seinen Fingern hindurch glitt, merkte, wie sich flauschige Fusseln in seiner Hand sammelten. Mit einer infantilen Genugtuung riss er noch fester, während es in seinem Geist schon zu dämmern begann.
Er bedauerte zutiefst, dass er nun nicht mehr die Dinge mit seinem Sohn tun würde, auf die er sich gefreut hatte. Erst vor wenigen Minuten hatte er beschlossen, sein Leben komplett zu ändern und mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen.
Und jetzt spürte Edwin, wie der Tod seine kalten Finger nach ihm ausstreckte. Er würde ihn nicht mehr loslassen.
Ingrid würde sich gut um den Jungen kümmern, da war er sich sicher.
Dann stellte er sich kurz die Frage nach dem Warum. Einen Sekundenbruchteil später entschied er, dass die Frage völlig unwichtig sei, denn unabhängig von dem Grund war das Ergebnis dasselbe.
Die Nacht, die ihn einfing, wurde immer schwärzer. Langsam entfernten sich die Schmerzen. Ebenso das Licht seines Büros, und auch der Fremde schien plötzlich nicht mehr da zu sein. Eine Ruhe kehrte ein, eine endlose, friedvolle Stille, die sich hinzog, bis sein Gehirn keinen Gedanken mehr dachte und keinen Traum mehr träumte.
Spiel, bis du stirbst (2010, ISBN 978-3942725002)
Äste schlugen ihr ins Gesicht und zeichneten eine Landschaft aus blutigen Kratzern auf ihre Haut. Egal. Gegen das, was sie zuvor hatte über sich ergehen lassen müssen, waren das beinahe Streicheleinheiten. Und sie musste weiter, wenn sie nicht zurück in die Hölle wollte. In keinem Fall durfte sie jetzt ausrutschen, sonst würde er sie haben. Aber es war so verdammt steil, und der feuchte Waldboden bot ihren nackten Füßen wenig Halt. Mehr stolpernd als laufend bewegte sie sich auf schmerzenden Fußsohlen den Abhang hinunter, immer wieder Halt an einem Baum suchend.
Obwohl sie genau wusste, dass sie damit unnötig Zeit verlor, zwang ihre stete Angst sie dazu, sich umzudrehen. Wie weit war er noch entfernt? Hatte sie genügend Vorsprung? Oder musste sie jeden Augenblick damit rechnen, dass er sich auf sie stürzte?
Nein, sie hörte zwar das beunruhigende Knacken von brechendem Holz hinter sich, aber zu sehen war er noch nicht. In diesem dichten Wald hatte das nicht viel zu bedeuten, denn die Sichtweite betrug auch ohne Nebel nur wenige Meter, so eng standen die Bäume zusammen. Zum Glück war es nicht dunkel. Das Licht des späten, trüben Nachmittags ließ sie wenigstens die fremde Umgebung erkennen.
Der Geruch, der in der Luft lag, kam ihr seltsam irreal vor. Die Wälder in ihrer Heimat rochen anders. Vielleicht befand sie sich ja doch in einem abstrusen Traum, und dieser Wald existierte gar nicht? Dann würde sie bald erwachen und alles war gut.
Ein Rufen, laut und aggressiv. Die Worte verstand sie nicht, obwohl sie klar und deutlich an ihre Ohren drangen. Es war nicht ihre Sprache.
Geräusche. Diese hörten sich an wie vorbeifahrende Autos. In der Nähe musste eine Straße sein. Ein Geschenk des Himmels!
Sie stolperte weiter. Als sie sich an einem schlanken Baumstamm festhalten wollte, sah sie nicht den spitzen, abstehenden Holzsplitter. Dieser drang mit voller Wucht in ihre Handfläche ein. Ein kurzes Aufstöhnen, dann nahm sie mit zusammengebissenen Zähnen die Hand vom Baum.
Sofort fing die Wunde an zu bluten, aber Schmerzen spürte sie kaum. Die Qualen, die noch immer zwischen ihren Beinen tobten, überdeckten alles andere. Tausend glühende Nadeln, die ihren Unterleib malträtierten, hätten nicht schlimmer sein können.
Kurz kam es ihr in den Sinn, wie erstaunlich es war, dass sie überhaupt noch laufen konnte. Doch die Pein, die sie in diesem dornigen Waldstück erlitt, war nichts gegen das, was sie über sich hätte ergehen lassen müssen, wenn sie geblieben wäre. Nur dieses Wissen war es, was sie aufrecht hielt. Dieses Wissen, und das in hohen Dosen ausgeschüttete Adrenalin. Selbst der Schwindel, mit dem ihr Kreislauf darauf aufmerksam machen wollte, dass sie ihre körperlichen Grenzen erreicht hatte, hinderte sie nicht daran, weiter zu laufen.
Das Rauschen des Verkehrs wurde lauter. Sie musste es nur bis zur Straße schaffen, dann hatte sie gewonnen. Ganz egal, wo diese Straße war oder wo sie hinführte: Solange sie stark befahren war, würde er ihr dort nichts mehr anhaben, dessen war sie sich sicher. Zu viele Augen könnten ihn später wiedererkennen.
Noch einmal das grimmige Rufen, diesmal lauter. Erneut vergeudete sie Zeit, indem sie sich gehetzt umblickte. Da war er, vielleicht noch zehn Meter entfernt. Seine Hände waren leer. Gut, er hatte keine Waffe bei sich. Trotzdem ließ sein Anblick ihr ohnehin schon rasendes Herz noch schneller schlagen. Wenn er sie einholte, würde er keine Waffe benötigen. Sie kannte seine enorme Kraft, der sie nichts entgegenzusetzen hatte. Doch die rettende Straße konnte nicht mehr weit sein.
Mit einem Satz überwand sie eine Stelle, an der es einen Meter senkrecht nach unten ging. Dabei prallte sie mit dem rechten Oberschenkel gegen eine Tanne. Als ihre Jeans heftig gegen die Wunde gedrückt wurde, brannte es wie Feuer, ebenso sehr wie die Glut der Zigaretten dort gebrannt hatte. Bilder schossen ihr durch den Kopf. Bilder von dem Mann, der gierig über ihr stand und unaussprechliche Dinge mit ihr tat. Strenge, aber auch erwartungsvolle Blicke.
Mit größter Überwindung zwang sie die Gedanken beiseite. Als wäre die sich überschlagende Stimme hinter ihr ein Startschuss gewesen, lief sie weiter. Plötzlich erblickte sie durch die Stämme hindurch ein vorbeifahrendes Auto. Das gab ihr neue Energie. Jetzt war es wirklich nicht mehr weit, und sie würde es schaffen.
Hinter sich hörte sie bereits die Geräusche des herannahenden Mannes, die sie vor Sekunden noch zu Tode erschreckt hätten. Doch die zum Greifen nahe Straße gab ihr die Kraft und die Überzeugung, nun nicht mehr verlieren zu können. Der weitere Adrenalinschub, ausgelöst durch die näher kommenden Geräusche in ihrem Rücken, tat sein Übriges, um sie voller Kraft voranschreiten zu lassen.
Für diesen Moment spürte sie keine Schmerzen mehr. Alle Gedanken an den Albtraum der letzten Wochen waren verschwunden, verbannt in den hintersten Winkel ihres Gehirns. Leichtfüßig sprang ihr graziler Körper zwei weitere steile Abhänge hinab, rutschte fast drei Meter über den glitschigen Boden, und richtete sich sofort wieder auf. Nach einigen Schritten auf einem annähernd ebenen Stück trennten sie nur noch knapp zwei Höhenmeter von der Straße, die feucht und dunkelgrau unter ihr lag. Als sie sprang, war ihr bewusst, dass sie sich vielleicht ein Bein brechen würde, aber es spielte keine Rolle. Sie würde gerettet sein, und nur das zählte. Noch bevor sie den nass glänzenden Asphalt berührte, hörte sie ein unbeherrschtes Brüllen, welches sie, auch ohne die Sprache zu kennen, eindeutig als Fluchen identifizierte. Für sie war es wie eine Bestätigung dafür, dass sie gewonnen hatte.
Ihre Knie und ihre Fußgelenke schmerzten beim Aufprall. Sie konnte nicht verhindern, dass ihr Körper durch den Schwung nach vorne geschleudert wurde. Um nicht frontal mit dem Gesicht aufzuschlagen, drehte sie sich zur Seite. Ihre linke Schulter knallte auf den harten Boden, und das knirschende Geräusch sagte ihr, dass etwas gebrochen war.
Den Bus, der sie erfasste, sah sie nicht. Es wurde einfach dunkel, in dem Moment, in dem ihr Genick von der Stoßstange gebrochen wurde. Ein paar Meter wurde sie mitgeschleift, dann verwandelten die Zwillingsreifen den größten Teil ihres filigranen Körpers in eine unidentifizierbare Masse.
Bald würde sie in den Polizeiakten als ein Unfallopfer geführt, dessen Identität nicht festgestellt werden konnte. Eine Tote, die scheinbar nirgendwo herkam und die niemand kannte … aus einem Waldstück gesprungen wie ein Reh und unter die Räder gekommen… bald vergessen, als hätte es sie nie gegeben.
Schattenraum (2008, ISBN 978-3981122954)
Als Evelin Svens Wohnungstür hinter sich zuzog, war es erst acht Uhr. Nach einem unruhigen und wenig erholsamen Schlaf war sie eine Stunde zuvor erwacht und hatte nicht mehr einschlafen können. Sie war trotzdem noch liegen geblieben, aber so sehr sie es auch ersehnt hatte: Der Schlaf hatte sich nicht wieder eingestellt.
Sven schien es anders gegangen zu sein, denn er war noch immer im Land der Träume. Da sie nicht wusste, wie lange er dort noch verweilen würde, hatte sie sich irgendwann angezogen und war gegangen. Es war ein ungutes Gefühl gewesen, in einer fremden Wohnung zu sein, alleine, ohne etwas mit sich anfangen zu können. Sie würde nach Hause fahren, sich einen Kaffee machen, und sehen, was es Neues im Chat gab.
Auf der Straße schaute sie sich um. Instinktiv hielt sie nach einem Wagen Ausschau, der mit laufendem Motor da stand, und dessen Fahrer nur auf sie wartete. Doch da war nichts Auffälliges. Mit schnellen Schritten ging sie zu ihrem silbergrauen Fiesta, sperrte ihn auf, ließ sich auf den Sitz fallen, und verriegelte die Tür, sobald sie ins Schloss gefallen war.
Dann startete sie den Motor, der etwas widerwillig zum Leben erwachte. Es war unangenehm kalt an diesem Morgen, so dass sie sofort den kühlen Zug an ihrem Kopf spürte, als sie losfuhr. Sie hatte am Vorabend das Fenster nicht richtig geschlossen. Offenbar war sie so in Panik gewesen, dass sie nicht daran gedacht hatte. Zum Glück hatte niemand das Auto geklaut. Schnell kurbelte sie das Fenster rauf.
Der morgendliche Berufsverkehr hatte die Stadt voll im Griff. Evelin war erleichtert darüber, dass sie nicht stadteinwärts fahren musste. Bald bog sie an der Miquelallee nach links ab. Weit hatte sie auf der Straße, die in der Verlängerung in die A66 nach Wiesbaden überging, nicht zu fahren. Dachte sie. Doch es kam alles ganz anders.
Was sie im Rückspiegel sah, ließ den Schrecken in ihre Glieder fahren. Ihr stockte der Atem, und das ohnehin schon schwermütige Herz setzte für ein paar Schläge aus. Nackte Panik erfasste sie, als ihre blankliegenden Nerven wie durch einen Blitzschlag abrupt die Wahrheit erfassten. Heiße und kalte Wellen durchfluteten ihren Körper abwechselnd im Millisekundentakt. Es waren nicht die Fahrzeuge hinter ihr, die sie in den Zustand panischer Angst versetzten. Es war der junge Mann, der sie aus dem Fond ihres eigenen Wagens angrinste. Mit der schwarzen Baseballmütze, die er verkehrt herum angezogen hatte, sah er fast aus wie ein Teen. Die runden Gläser seiner Brille erinnerten Evelin an Harry Potter. Doch das fiese Grinsen passte weder zu einem Teenager noch zu dem Zauberlehrling.
„Guck besser auf die Straße“, ermahnte sie der Fremde, in dem sie nach Svens Phantombild sofort den Mann erkannte, der Frank getötet hatte.
Die Stimme des Mannes brach den Bann, der sie in eine Lähmung des Entsetzens versetzt hatte. Ruckartig brachte sie den Ford wieder in seine Spur, denn es fehlten nur noch wenige Zentimeter, die ihn von dem LKW auf dem Nachbarfahrstreifen trennten.
Dann spürte sie rechts an ihrem Hals etwas. Etwas Kaltes, Spitzes berührte sie nicht nur, sondern bedrängte sie derart, dass sie sich ein wenig nach links neigte.
„Du wirst tun, was ich sage.“ Die Stimme drang von weit entfernt durch das Rauschen ihres eigenen Blutes, das in ihr zu kochen schien und in ihren Ohren dröhnte. „Wenn nicht, wird sich dieses Messer ganz schnell sehr tief in deinen Hals bohren. Es wird bis in deine Luftröhre vordringen, und das Blut wird in deine Lungen laufen. Qualvoll wirst du langsam an deinem eigenen Saft ersticken.“
Woher sie die Kaltblütigkeit nahm, konnte sie nicht sagen, aber sie antwortete: „Dann würden Sie sich selbst mit umbringen. Ich glaube kaum, dass sie das wollen.“ Ihre Stimme entsprach genau dem Gegenteil von ihrem tatsächlichen Zustand: Sie war fest, klar und laut.
Ein hämisches Lachen war die Reaktion. „Das glaubst aber auch nur du. Was habe ich denn zu verlieren? Ich bin ein zweifacher Mörder. Der Tod wäre immer noch besser als der Knast. Aber du wirst es sowieso nicht ausprobieren, denn du hast viel zu viel Angst vor den Folgen. Und jetzt wirst du immer schön auf der Autobahn bleiben, bis ich dir etwas anderes sage.“
Gerade in diesem Moment kam eine Abfahrt, und Evelin hatte nichts Besseres zu tun als auf den Verzögerungsstreifen zu wechseln. Der Schmerz war unbeschreiblich. Mit einem furchtbaren Ruck drang der Stahl in ihren Hals ein. Nicht einmal sehr tief, aber Evelin schrie gellend auf und verriss das Lenkrad. Mit aller Gewalt versuchte sie, den Wagen wieder unter Kontrolle zu bringen.
Das Messer war plötzlich verschwunden, dafür spürte sie eine warme Flüssigkeit den Hals herablaufen.
Auf der linken Seite näherten sie sich bedenklich einem Reisebus. Erst im allerletzten Moment konnte sie einen Zusammenstoß verhindern. Rechts neben ihnen ertönte eine Hupe. Kurz darauf zog mit überhöhter Geschwindigkeit ein großer Mercedes vorbei. Dann hatte Evelin den Fiesta endlich wieder in der Gewalt.
Keine Sekunde später war das kalte Metall wieder da. Die Spitze drückte sich tief in ihren Hals, gerade noch so schwach, dass es nicht an der neuen Stelle zu bluten begann.
„Siehst du“, sagte der Mann hinter ihr scharf, „du hättest das Auto jetzt auch in den Bus krachen lassen können, aber du hast es nicht getan. Zum einen hängst du zu sehr an deinem eigenen Leben, und zum anderen weißt du genau, dass bei einer Massenkarambolage unzählige unschuldige Menschen sterben würden. Vielleicht wären sogar kleine Kinder dabei, oder nette Männer, wie dein Frank einer war, die dann niemals wieder zu ihren wartenden Frauen zurückkehren. Das möchtest du doch nicht! Und ich weiß, dass du das nicht möchtest. Ich bin einfach zu schlau für euch. Weißt du, ich werde immer gewinnen, weil ich genau weiß, was ich tue.“
Evelin begann zu zittern, so stark, dass sie Schwierigkeiten hatte, das Lenkrad festzuhalten. Das Schwein hatte Frank auf dem Gewissen. Frank. Ihren Frank. Und nun war sie in der gleichen Situation wie er. Würde sie sterben? Wäre es schlimm, wenn sie es tun würde? Vielleicht wäre sie dann wieder mit Frank vereint. Oder würde sie in die Hölle kommen, weil sie ihren Mann betrogen hatte? Gab es eine Hölle? Gab es einen Himmel?
In diesem Moment wurde es ihr gleichgültig, ob sie sterben würde, solange sie davor nicht allzu sehr leiden musste. Aber der Mann hatte natürlich recht. Sie konnte nicht das Leben von Anderen aufs Spiel setzen. Irgendwann würden sie stehen bleiben müssen, und dann hatte sie vielleicht eine Gelegenheit zu entkommen. Mit etwas Glück würde auch jemand den Vorfall von eben bei der Polizei melden, und eine Streife würde sie anhalten. Dann hätte sie gewonnen.
Bis zum Wiesbadener Kreuz fuhren sie schweigend weiter. Dort dirigierte sie der Fremde auf die A3 in Richtung Köln. Ihr Weg war nun nicht mehr weit, denn an der Autobahnraststätte Medenbach ließ er sie abfahren.
Während sie den Wagen auf dem Verzögerungsstreifen abbremste, bewegte sich der Mann hinter ihr, ohne dass sie feststellen konnte, was er tat. Kurz daraufhin spürte sie es. Offensichtlich hatte er ein zweites Messer hervor geholt, welches er ihr jetzt von links an den Hals hielt.
„Damit du nicht auf die Idee kommst, aus dem Auto zu springen, sobald wir anhalten. Egal, in welche Richtung du dich bewegst: Du wirst deinen Hals in eines der Messer treiben. Um es für dich noch interessanter zu machen, schneide ich dabei die Nerven an der Wirbelsäule durch. Du wirst dann nichts mehr spüren, aber dein Kopf wird dir sagen, dass da ganz viel Blut aus deinem Hals quillt. Jeder Versuch, deine Arme mit mentaler Kraft zu heben um nach der Wunde zu greifen, wird scheitern. Egal wie groß deine Panik sein wird, du wärest nicht einmal in der Lage, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Also, benimm dich!“
Er ließ sie auf eine Parkposition fahren, in dessen unmittelbarer Nähe keine anderen Fahrzeuge standen.
„Und jetzt nimmst du die Arme zur Seite, lässt sie herunter hängen, und drehst sie so weit wie möglich nach hinten.“ Bei diesen Worten verstärkte er den Druck der beiden Messer. Evelin stöhnte auf und kam seiner Aufforderung nach. Was sollte sie auch tun? Hätte sie die Tür aufreißen und einen Fluchtversuch riskieren sollen?
Die Klinge auf der rechten Seite verschwand. Evelin hatte das Gefühl, dass ihre Wunde nicht mehr blutete. Zumindest spürte sie nichts Nasses mehr an ihrem Hals.
Aus dem Fond waren metallische Geräusche zu hören. Dann legten sich kalte Stahlfesseln um ihr rechtes Handgelenk. Das Klicken von einrastenden Handschellen erfüllte den kleinen Raum. Kurz darauf war das Messer auf der rechten Seite wieder zu spüren, dafür verschwand das linke. Die Prozedur mit den Handschellen wiederholte sich an ihrem zweiten Handgelenk.
Offenbar hatte der Mann die beiden Handschellen mit einem Seil oder einer Kette miteinander verbunden, oder er hatte sich gleich eine Spezialanfertigung besorgt. In jedem Fall war Evelin nun gefesselt, und ihre Arme wurden noch ein Stück weiter nach hinten gezogen, so, als ob der Killer die Verbindung zwischen den beiden Fesseln verkürzte.
Anschließend passierte lange Zeit nichts. Es dauerte sogar solange, dass Evelin irgendwann fragte: „Und nun?“
„Wir warten“, antwortete Franks Mörder, ohne darauf einzugehen, worauf sie warteten. Evelin hatte bald jedes Gefühl für Zeit verloren. Was hatte er mit ihr nur vor? Wenn er sie töten wollte, dann hätte er das schon längst tun können. Auf der anderen Seite: Wenn sie tot hinterm Steuer saß und jemand vorbeikam, konnte das durchaus auffallen. Immerhin waren sie auf einem öffentlichen, gut besuchten Parkplatz, mitten am Tage. Nein, hier würde er sie nicht umbringen können, sein Ziel musste ein anderes sein. Dieser Gedanke beruhigte Evelin ein wenig. Vielleicht würde sich dann doch noch eine Gelegenheit zur Flucht bieten.
Es musste mindestens eine Viertelstunde Stille geherrscht haben, in der sie es vermied, in den Rückspiegel zu schauen. Vielleicht war es auch schon eine halbe oder sogar eine ganze Stunde gewesen, Evelin wusste es nicht zu sagen. Mit der Zeit waren die Scheiben von ihrem Atem so beschlagen, dass man nicht mehr hinausschauen konnte. Deshalb hatte er also das Fenster ein wenig geöffnet gehabt, während er vor Svens Haus auf sie gewartet hatte. Ihr wären sonst sofort die von innen beschlagenen Scheiben aufgefallen!
Jetzt verschwand auch das zweite Messer von ihrem Hals. Bei einem vorsichtigen Blick in den Rückspiegel stellte Evelin fest, dass der Kerl sie nicht aus den Augen ließ, obwohl er außerhalb ihres Blickfeldes irgendetwas mit seinen Händen zu tun schien. Bald würde auch der Spiegel so sehr beschlagen sein, dass man nichts mehr darin sehen würde.
Es dauerte einen Moment, dann beugte sich der Fremde vor, und sie spürte zwei Dinge. Einmal einen undefinierbaren Gegenstand an ihren Lippen, und zum anderen wieder ein Messer, welches ihre linke Wange berührte.
„Mund auf!“, befahl der Mann. Kaum war sie dieser Aufforderung nachgekommen, drückte er ihr eine große Kugel in den Mund. Sie war so groß, dass ihr Mund noch weiter aufgedrückt wurde, so weit, dass sie vor Schmerz stöhnen musste. Das Messer verschwand, und ein gummiartiger Gurt, der scheinbar mit der Kugel verbunden war, legte sich um ihren Kopf. Sofort wusste sie, um was es sich handelte. So lange, wie sie in diesem Erotikchat gewesen war, kannte sie alle möglichen Spielzeuge, die in den verschiedenen Spielarten Anwendung fanden. Die meisten kannte sie freilich nur von Bildern aus dem Internet. Ein Knebel wie dieser war in der SM-Szene sehr gebräuchlich, allerdings hatte Evelin nicht gewusst, dass es welche in dieser unvorstellbaren Größe gab. Sie hatte das Gefühl sich einen Leberkloß in den Mund gestopft zu haben, den sie jetzt nicht kauen konnte.
Nun wurden ihre Arme noch weiter nach hinten gezogen, so sehr, dass Evelin vor Schmerz aufgeschrien hätte, wenn sie nicht den Knebel im Mund gehabt hätte. So entwich ihr nur ein leises Stöhnen.
„Siehst du“, sagte der Mann triumphierend, „du hättest früher schreien müssen. Schreien, oder irgendetwas anderes tun. Nun ist es zu spät. Du kannst dich nicht rühren, kannst nicht nach Hilfe rufen, und gesehen werden kannst du auch nicht mehr. Von außen sieht man nur ein geparktes Auto, dessen Scheiben beschlagen sind.“ Einige undefinierbare Geräusche ließen sich vernehmen.
Jetzt wollte Evelin doch wissen, was er tat, und blickte in den Spiegel. Doch sie wurde enttäuscht, man konnte nichts mehr darin erkennen.
Ein Kichern drang in ihren Kopf, leise, hämisch, verrückt. „Ist das nicht genial? Du wirst inmitten zahlloser Menschen sterben, und keiner bekommt es mit!“
Eine jähe Erkenntnis durchfuhr Evelin: Es war ein großer Irrtum gewesen zu glauben, dass sie an diesem Ort sicher war, weil sich sehr viele Leute um sie herum befanden. Nur solange die Sicht in ihren Wagen noch frei gewesen war, hatte sich der Mörder zurückhalten müssen. Wie ein Blitzschlag, der durch ihren ganzen Körper fuhr, ergriff sie das blanke Entsetzen. Im panischen Versuch, sich im letzten Moment noch loszureißen, straffte sie den Körper, soweit es ging, spannte jeden Muskel an, und obwohl das in hohem Maße ausgeschüttete Adrenalin in ihren Adern dem Körper zusätzliche Kraft verlieh, hatte sie nicht die geringste Chance. Auch ihr Bestreben lauthals zu schreien war vergebens. Lediglich einen leisen Laut brachte sie zustande, ein Laut, der in ihrer Kehle schmerzte. Der plötzlich aufgetretene Schock ließ sie die Schmerzen kaum spüren. Ebenso wenig merkte sie, ob der Mann ihr eines der Messer irgendwo hinein stach. Sie war nur noch erfüllt von Furcht und Panik, freigesetzt durch das Wissen, dass sie gleich sterben sollte. Mit aller Macht wand sie sich in ihrem Sitz, tat sich dabei selbst weh, ohne es zu merken, versuchte erneut zu schreien, aber alle Bemühungen waren umsonst. Außer, dass ihr der Schweiß in Strömen ausbrach, erreichte sie nichts.
Netzinfarkt (2007, ISBN 978-3981122916)
Abdul war froh, einen der 53 Sitzplätze in der ersten Klasse gebucht zu haben. Es war auch nicht irgend ein Sitzplatz der ersten Klasse, sondern ein Platz direkt im Triebwagen. Nur eine Glasscheibe trennte Abdul von der Fahrerkabine. So hatte man die Möglichkeit, die ganze Fahrt aus Sicht des Fahrers zu betrachten. Die Schienen flogen nur so unter dem Zug hinweg. Die starken Motoren des ICE Typ 3 brachten dem Zug eine Geschwindigkeit von weit über 300 Kilometer in der Stunde. Natürlich wurde die enorme Geschwindigkeit nicht über die gesamte Fahrzeit beibehalten, aber immerhin schmolz die Strecke Frankfurt-Köln auf etwas über eine Stunde. Da lohnte es sich kaum, das Flugzeug zu nehmen. Im Moment war die Geschwindigkeit noch nicht sehr hoch, man befand sich kurz hinter dem Flughafen Frankfurt, und der Zug beschleunigte noch. Abdul war schon am Hauptbahnhof eingestiegen, das hatte er sich nicht nehmen lassen. Zu lange hatte er schon auf diesen Tag gewartet. Endlich war es so weit. Er genoss die Aussicht aus dem Fahrerfenster. Es gefiel ihm. Die Erbauer dieser gewaltigen Maschine hatten auch an die Passagiere gedacht. Aber das war es nicht, weshalb er sich über sein Ticket der ersten Klasse so freute. Es hatte eher praktische Gründe. Das, was er tun wollte, war nur hier vorne wirklich erfolgversprechend. Die dummen Menschen. Sie machten peinlich genaue Kontrollen für jedes Flugzeug, das Frankfurt verließ. Das war offenbar wichtig, weil so viele Menschen darin saßen. Aber da hörte die Mühe, die sie sich gaben, auch schon auf. Abdul hatte sich erkundigt. In einem Mehrsystem-ICE hatten 404 Menschen Platz, in einem Einsystem-Zug sogar 415.
Es sollte Aufsehen erregen, hatte man ihm gesagt. Und genau das würde es tun. Aufsehen erregen. Für Abdul war es der Schlüssel zum Paradies. Allah würde ihn willkommen heißen in seinem Reich. Und es hatte niemand mehr verdient als er. Fünf Jahre hatte er in diesem entsetzlichen Land zugebracht. Dass die Menschen kein Verständnis für seine Religion hatten, war eine Sache. Aber sie hatten noch nicht einmal Verständnis für ihre eigene Religion. Sie lebten alle nur für materiellen Reichtum. Um das zu erlangen, war ihnen beinahe jedes Mittel recht. Sie logen und betrogen, verrieten ihre besten Freunde, ließen ihre Familien im Stich, nur um an noch mehr Geld heran zu kommen. Das beste Mittel war der harte Ellenbogen, wenn man etwas erreichen wollte. Nicht einmal hatte Abdul einen Deutschen gesehen, der sich auf der Straße zum Gebet niedergelassen hatte. Die Gotteshäuser ihrer Religion waren mehr leer als voll. Die Sympathie eines Menschen war stark davon abhängig, was er besaß. Dann regten sich immer alle darüber auf, wenn eine Frau vergewaltigt wurde. Dabei waren sie doch alle selbst schuld! Nicht genug damit, dass sie ihr Haar offen trugen und ihr Gesicht unverhüllt zu erkennen gaben. Häufig, gerade im Sommer, war bei den Frauen mehr Haut als Stoff zu sehen! Freie Bauchnabel, teils sogar geschmückt mit teuren Ringen, waren zu sehen, ebenso wie große Teile der nackten Beine! Bei der jüngeren Generation hatte Abdul auch schon Teile des Gesäßes entdeckt, weil die Hosen nach oben hin einfach nicht darüber reichten. Er selbst hatte schon die Brut des Verlangens in sich gespürt, und konnte sich nur schwer beherrschen. Und da jammerten die Menschen, dass so oft etwas passierte. Wenn Abdul jemals Zweifel gehabt hatte: seitdem er in Deutschland lebte, gab es nicht den geringsten mehr! Der Koran hatte recht, mit jeder einzelnen Silbe. Und diese Ungläubigen würden es zu spüren bekommen. Es würde ihnen niemals gelingen, ihre Sicherheitsvorkehrungen so weit auszudehnen, dass die richtende Hand Allahs keinen Zugriff mehr hätte. Es war alles so einfach. Frankfurt war ein Schlaraffenland für Leute, die Waffen suchten. So brauchte Abdul sich auch keine Gedanken darüber zu machen, ob ihn jemand am Ende noch hindern könnte, seine Mission zu erfüllen. Die neun Millimeter Pistole in seiner Tasche würde schnell jedes Problem aus dem Weg räumen. Den Verbindungsmann zu dem Sprengstofflieferanten hatte er bereits in seiner Heimat genannt bekommen. Seine Heimat. Nie würde er sie mehr wieder sehen. Aber die Erinnerung war stark genug. Er konnte sich an jede Einzelheit erinnern. Und niemand würde ihn vergessen. Seine Familie wird stolz auf ihn sein, seine Freunde werden ihn einen Helden nennen. Die ganze Welt würde seinen Namen kennen. Und unter der Obhut von Allah wird er auf sie nieder blicken und die Wirkung seiner Tat bewundern.
Für einen kurzen Moment überkamen ihn Zweifel. Nicht darüber, ob sein Tun richtig war, denn das stand außer Frage. Aber vielleicht wäre es doch besser gewesen, den Sprengstoff an der Brücke zu deponieren. Wenn sie einstürzte, dann war ein Entgleisen des Zuges unausweichlich. Der Sprengstoffexperte hatte ihm jedoch gesagt, dass die Sprengung einer großen Brücke genaue Kenntnisse über die Statik des Objektes erforderte. Wenn die Ladung an einer falschen Stelle angebracht war, würde sie ihre Wirkung verfehlen. Abdul war alles andere als ein Experte in diesen Dingen. Deshalb hatte er sich entschieden, es doch im Zug zu tun. Ganz vorne, auf der linken Zugseite stehend, würde die mächtige Druckwelle den Zug anheben und nach rechts aus den Schienen katapultieren. Wenn Abdul den Auslöser direkt in der Mitte der Brücke drückte, würde der Triebwagen den gesamten, restlichen Zug mit in die Tiefe reißen. Ohne die geringste Nervosität drehte der Mann sich um und betrachtete die anderen Fahrgäste. Bald würde keiner von ihnen mehr leben. Da war die junge Mutter mit ihrem ständig nörgelnden Kind. Der Geschäftsmann, der fortwährend auf der Tastatur seines Laptops herumklimperte. Das ältere Ehepaar, welches, offenbar in Urlaubsstimmung, hin und wieder laut auflachte. Viele Menschen, die für Abdul ohne Gesicht und Persönlichkeit waren. Sündiger, die nicht die leiseste Ahnung von dem hatten, was sie in Kürze erwartete. Niemand, der Abdul besondere Beachtung schenkte. Warum auch? Er war ein Fahrgast wie jeder andere auch. Und ein Attentat auf einen großen Zug würde niemand erwarten. Vor abstürzenden Flugzeugen hatte man Angst. Hier fühlte sich jeder sicher. Auch der große Unfall bei Eschede hatte langfristig nichts daran geändert.
Das kleine Kind kam plötzlich auf Abdul zugerannt. Es handelte sich um ein Mädchen von vielleicht drei Jahren. Es lachte Abdul fröhlich an, blieb direkt vor ihm stehen, zeigte auf Abduls Gesicht, und sagte: „Bart!“ Dabei lachte das Kind giggelnd. Mit seinen zotteligen, roten Haaren und den vielen Sommersprossen im Gesicht sah es so unschuldig aus. Die Augen blickten ihn offen und direkt an. Abdul lächelte zurück. Ich werde dich davor bewahren, dass du ebenso verdorben wirst wie deine Mutter, dachte Abdul. Er streichelte ihr über das Haar. Dann drehte sich das Mädchen um und lief laut lachend zur Mutter zurück. Die sah zu Abdul herüber und lächelte ebenfalls. Sie war schön. Wohlbeleibt, wie es sich für eine gute Mutter gehörte. Die Bluse war so weit aufgeknöpft, dass der Ansatz ihrer Brüste zu sehen war. Angewidert schaute Abdul zur Seite. Eine Weile lauschte er nur den leisen Fahrgeräuschen der Bahn. Fast war es in diesem Fahrzeug, als würde man fliegen, so ruhig glitt der Hochgeschwindigkeitszug über die extra für ihn entwickelten, neuartigen Gleise. Die Übergänge der einzelnen Schienenteile waren nicht zu merken, und die Kurven waren so weit gebaut, dass man sie kaum spürte.
Bei dem Blick aus dem Fenster sah Abdul, dass es nicht mehr weit war. Mit einem schnappenden Geräusch ließ er die Verschlüsse seines Pilotenkoffers aufspringen. Dann öffnete er die Tasche und sah hinein. Der Plastiksprengstoff mit dem einfachen Namen C4 füllte fast den gesamten Innenraum aus. Man hatte ihm gesagt, dass es mehr als ausreichen würde. In der rechten Ecke befand sich der Schalter. Wenn er ihn umlegte, würde es geschehen. Die beste Tat seines Lebens stand kurz bevor. Ein unsagbares Glücksgefühl machte sich in ihm breit. Er durfte ein Auserwählter sein! Wie wenigen wurde doch dieses Glück zu teil! Seine Kinder werden mit Ehre überschüttet werden.
Und all diese Leute in dem Zug hatten keine Ahnung. Ihr Leben lang hatten sie gesündigt, und wussten nicht, dass sie nun gerichtet würden. Allah war groß. Manchmal war er sehr geduldig, aber irgendwann vollzog er sein Werk an jenen, die es verdienten. Und heute war Abdul Allahs ausführende Hand. Abduls Glücksgefühl wuchs mit jeder Sekunde. Gleichzeitig stieg die Spannung in ihm. Er durfte den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Würde er zu spät abdrücken, dann konnte es passieren, dass die nachfolgenden Wagen nur umkippten. Es wäre die Möglichkeit gegeben, dass es Überlebende gab. Dasselbe konnte geschehen, wenn er zu früh auf den Zünder drückte. Höchste Konzentration war jetzt gefragt. Wie würde er vor Allah dastehen, wenn sein Vorhaben misslang? Aber er würde nicht versagen, da war er sich sicher. Zum zwanzigsten Mal fuhr er diese Strecke nun, kannte sie in und auswendig, wusste jeden vorbeihuschenden Ort im Voraus. Genauso kannte er den Tunnel, in den der Zug soeben einfuhr. Und niemand war da, der ihn zu hindern versuchte. Wie hätte auch jemand ahnen können, was er in seiner Tasche trug, deren Transport ihm wegen des hohen Gewichts so schwer gefallen war. Plötzlich, kurz nach Verlassen des Tunnels, tauchte sie vor ihm auf: die Brücke, die sein Grab werden würde. Rechts daneben befand sich die Autobahnbrücke der A3. Mit etwas Glück würde die Explosion auch Auswirkungen auf sie haben. Abdul hatte ein verzücktes Lächeln im Gesicht, während er der schnell nahenden Brücke entgegensah. Stolz erfüllte ihn. Er hatte an alles gedacht. Sogar daran, nicht einen Zug in den Abendstunden zu nehmen, weil der ICE da aus Lärmschutzgründen mit verminderter Geschwindigkeit über die Brücke fuhr. Das hatte seinen guten Grund, denn direkt neben der Brücke breitete sich Niedernhausen aus. Es gab Anwohner, die weniger als hundert Meter von der Brücke entfernt wohnten. Zwar stand noch die breite Autobahnbrücke dazwischen, die auch über eine durchsichtige Schallschutzmauer verfügte, aber bei einer Geschwindigkeit über 200 Stundenkilometer reichte das nicht aus.
Sie fuhren gerade auf die Brücke ein, als etwas an seiner Kleidung zerrte. Erschrocken drehte Abdul sich um, und blickte direkt in die Augen des kleinen Mädchens.
„Bart“, sagte sie, wobei sie ihn anstrahlte.
Abdul lächelte zurück. „Bart“, antwortete er, und drückte den Knopf.
Der Sprengstoff war viel stärker, als Abdul es für möglich gehalten hatte, aber das bekam er nicht mehr mit. Gemeinsam mit dem kleinen Mädchen wurde er im Bruchteil einer Sekunde annähernd pulverisiert.
Hals in der Schlinge (2006, ISBN 978-3981122909)
Was zum Teufel hatte Stefan in dieser abgelegenen Ecke verloren? Hier gab es absolut nichts. Die Straße endete auf einem schlammigen Parkplatz neben einem rostigen Baucontainer.
Ich versuchte durch den dichten Vorhang aus Regen Stefans Auto zu erkennen. Da war etwas in einiger Entfernung vor mir, das konnte er sein. Anscheinend war der Platz größer, als ich zunächst angenommen hatte.
Im Scheinwerferlicht sah ich direkt vor mir riesige Pfützen. Ich befürchtete, mit meinem Volvo in einem der Schlammlöcher stecken zu bleiben, wenn ich weiter fuhr. Warum zum Teufel hatte Stefan nicht einfach den ADAC angerufen? Vielleicht hatte er keine Mitgliedschaft? In dem Fall würde ich jetzt einfach meine Mitgliedskarte benutzen. Nichts in der Welt würde mich dazu bringen, meinen Wagen bei diesem Sauwetter mitten im Nirgendwo festzufahren.
Als ich mehrfach kurz hintereinander die Lichthupe betätigte, blendete ich mich selber. Der Regen war so dicht, dass er das grelle Fernlicht reflektierte. Aber es ging mir nicht darum, besser sehen zu können. Ich wollte mit dem Lichtzeichen erreichen, dass Stefan zu mir kam. Ich wiederholte das Aufblenden einige Male in halbminütlichen Abständen.
Als Stefan auch nach fünf Minuten nicht auftauchte, griff ich zum Handy.
Der Versuch eines Anrufs scheiterte: Ich bekam kein Signal. Verdammt. Ich musste wohl oder übel aussteigen. Die Alternative wäre gewesen, einfach wegzufahren. Aber Stefans E-Mail war eindeutig gewesen. Wir wollten uns hier treffen, und ich sollte ihn abschleppen. Er musste also da sein.
Ich mochte es nicht, Dinge zu tun, zu denen ich keine Lust hatte. Um genau zu sein, hasste ich es. Und hinaus in diesen strömenden Regen zu gehen, darauf hatte ich definitiv keine Lust. Wenn ich Stefan nicht so lange gekannt hätte…
Hätte ich gewusst, was mir bevorstand, dann wäre ich nach der Arbeit erst nach Hause gefahren, um mir etwas Passenderes anzuziehen.
Vom Rücksitz zerrte ich meine blaue Regenjacke und zog sie umständlich an. Sie würde wenigstens den oberen Teil meines Körpers trocken halten. Bevor ich die Tür aufstieß, zog ich die dünne Kapuze weit ins Gesicht. Das Schlimmste bei Regen war, dass ich wegen der Tropfen auf der Brille kaum etwas sehen konnte. Und ohne Brille erkannte ich mit meinen neun Dioptrien fast gar nichts. Lediglich Umrisse waren noch vorhanden, und das auch nur von größeren Objekten.
Als ich den Wagen verließ, peitschte mir der Wind den Regen heftig ins Gesicht.
Ich fluchte. Stefan schuldete mir etwas. Der Abend würde auf ihn gehen.
Ich beeilte mich, die Tür zuzuwerfen, damit ich mich später nicht ins Nasse setzen musste. Dann ging ich in die Richtung des Autos, das ich für Stefans hielt. Damit lief ich genau gegen die Windrichtung. Um die Distanz schneller hinter mich zu bringen, versuchte ich zu rennen und wäre beinahe gestürzt. Ich spürte, wie mein rechter Fuß im Matsch wegrutschte, und trat schnell mit dem linken auf, um mich mit ihm abzustützen. Dabei erwischte ich offenbar die tiefste Pfütze, die der Platz zu bieten hatte, denn augenblicklich stand ich bis über den Knöchel im Wasser. Verdammt, Stefan, was hast du hier überhaupt verloren gehabt?
Während Stefans Schulden bei mir immer größer wurden, kämpfte ich mich weiter voran.
Ich bekam eine Gänsehaut, als mir eiskaltes Wasser am Hals herab rann und den Weg zu meiner Brust fand. Mit der rechten Hand versuchte ich, meinen Kragen fest zuzuhalten, damit kein Wasser mehr durchkam. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen. Rutschend und mit durchtränkten Schuhen und Socken kam ich voran.
Für einen Moment erhellte ein Blitz die Szenerie. Fast zeitgleich grollte ein gewaltiger Donner, der die Erde erbeben ließ. Augenblicklich konnte ich das Fahrzeug erkennen. Obwohl ich auch vorher keinen Zweifel daran gehabt hatte, war ich jetzt sicher, dass es Stefans Auto war. Wenige Meter davor ragte ein schmaler, hüfthoher Stock aus der Erde.
Je nasser ich wurde, umso schlechter war ich auf meinen Freund zu sprechen. Warum war er nicht ganz vorne stehen geblieben? Warum wartete ich nicht einfach im Auto? Ich hätte so lange hupen können, bis Stefan sich gerührt hätte.
Als ich nur noch wenige Schritte entfernt war, offenbarte mir der nächste Blitz, dass es sich bei dem Stock in Wirklichkeit um eine Schaufel handelte, die zu zwei Drittel des Blattes in der Erde steckte. Hatte Stefan etwa versucht, seinen Wagen freizuschaufeln? Absurder Gedanke. Ich ging an der Schaufel vorbei, und steuerte auf den dunkelgrünen Omega zu, wobei ich jedoch stolperte und mein Gleichgewicht nicht mehr halten konnte.
Platsch!
Verdammt! Das konnte Stefan gar nicht wieder gut machen!
Ich kam umständlich auf die Knie, hustete, schmeckte den lehmigen Geschmack der Brühe, würgte. Nur mit Mühe gelang es mir, mich nicht zu übergeben. Es dauerte eine halbe Minute, bevor ich in der Lage war aufzustehen. Als ich endlich wieder auf den Beinen war, blickte ich an mir herab, konnte aber nichts erkennen, weil es so dunkel war. Ich ärgerte mich, dass ich das Licht an meinem Auto nicht angelassen hatte.
Die Dämmerung war jetzt soweit fortgeschritten, dass es bald stockfinster sein würde.
Worüber war ich überhaupt gestolpert? Ich drehte mich um. Vor mir sah ich schemenhaft eine Erhöhung auf dem Boden. Sie war mir vorher nicht aufgefallen, und ragte etwa zwei Handbreit aus dem Schlamm heraus. Das unförmige Gebilde war zwei bis drei Schritte lang. Vielleicht ein alter Sack, in dem sich Müll befand? Aber dazu war er zu massiv. Egal.
Immerhin konnte es jetzt kaum noch schlimmer kommen. Dachte ich. Doch schlimmer geht immer. Der nächste Blitz zeigte es mir. Die beiden weit aufgerissenen Augen, die mich aus dem oberen Teil des vermeintlichen Sacks heraus anstarrten, ließen mir das Blut in den Adern gefrieren. Plötzlich war mir bewusst, dass der Sack in Wirklichkeit mein Freund Stefan war. Der Augenblick des Lichts währte nur kurz, trotzdem erfasste ich im Bruchteil einer Sekunde, dass die Schädeldecke merkwürdig verunstaltet aussah. Von der Stirnmitte breiteten sich dunkle Flecken aus, die ich auch ohne gründliche Untersuchung als Blut identifizierte. Auf der anderen Seite: War das überhaupt möglich, dass sich bei diesem Dauerregen das Blut auf seiner Haut hielt? War es am Ende eine riesige, offene Wunde, die ich gesehen hatte? Ein Schauer durchzog meinen Körper, als ich plötzlich das Gesehene im Geiste mit einem gespaltenen Schädel verband.
Plötzlich fing mein Herz an zu rasen, und für einen Moment konnte ich keine Luft holen. Zu vehement war der Schock gekommen. Obwohl es längst wieder dunkel war, brannte das Bild der mich anstarrenden Augen auf meiner Netzhaut. Augen, die seltsam leer waren. In diesem dunklen, abgelegenen Nirgendwo, inmitten einer Hölle aus Regen, Schlamm, Blitz und Donner, hatte der Anblick etwas extrem Gruseliges und jagte mir eine Heidenangst ein.
Ich musste etwas tun. Meine Güte, wie viele Jahre war es her, dass ich den Erste-Hilfe-Kurs besucht hatte?
Mein Handy. Ich könnte Hilfe rufen. Ja, das war das Beste! Mit nassen und zitternden Fingern fischte ich mein Mobiltelefon aus meiner Hemdtasche. Fast wäre es mir aus der Hand gerutscht, so glitschig war alles. Als das Display nach dem ersten Tastendruck leuchtete, atmete ich auf. Zum Glück war es durch das Wasser nicht kaputt gegangen.
Ich wählte die 110. Ohne Erfolg. Ich hatte kein Netz. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt!
Licht. Ich brauchte Licht, wenn ich Stefan helfen wollte. Sollte ich doch versuchen, mein Auto zu holen? Aber wenn ich dabei selber im Schlamm stecken blieb, war damit niemandem geholfen.
Doch irgendetwas musste ich tun. Ich ging in die Knie, und tastete mit meinen schlammverschmierten Händen nach seinem Gesicht. „Stefan“, rief ich laut, mehrmals hintereinander. Nachdem ich die Wangen erfühlt hatte, tätschelte ich sie, während ich weiter den Namen meines Freundes rief.
Als nach einer Weile keine Reaktion kam, tastete ich vom Kopf über seine Schultern bis zu seiner linken Hand, und suchte nach der Pulsader. An verschiedenen Stellen versuchte ich, etwas zu fühlen. Keine Chance. Ich legte meine Hand auf die Stelle, die ich für seinen Bauch hielt, in der Hoffnung, dass dieser sich hob und senkte. Aber er tat es nicht. Immer wieder sagte ich seinen Namen, aber es kam keine Reaktion. Ich merkte, dass mir sehr heiß war, obwohl es recht kalt und ich völlig durchnässt war. Ich zitterte, als ob ich Schüttelfrost hatte.
Hier konnte ich nichts für ihn tun. Ich musste Hilfe holen, und das so schnell wie möglich. Meine Güte, lebte Stefan überhaupt noch? Eigentlich hätte ich vermuten müssen, dass er tot war, nachdem ich keinen Puls feststellen konnte. Aber wahrscheinlich bewirkte alleine mein Wunschdenken, dass ich davon ausging, dass Stefan noch lebte.
Mehr rutschend als gehend erreichte ich mein Fahrzeug. Jetzt verschwendete ich keinen Gedanken mehr daran, ob meine Sitze nass oder gar dreckig wurden. Ich riss die Tür auf und ließ mich hinters Lenkrad gleiten.
Nachdem ich den Motor gestartet hatte, trat ich die Kupplung durch und legte den Rückwärtsgang ein. Prompt würgte ich den Motor ab, als ich mit den nassen, aalglatten Sohlen meiner Businessschuhe von dem Pedal abrutschte. Musste denn alles schief gehen?
Ich war den Tränen nahe, vielleicht vor Wut, vielleicht vor Angst um Stefan. Der nächste Versuch gelang besser. Mit durchdrehenden Rädern hüpfte der Volvo rückwärts. In Panik gab ich viel zu viel Gas, und als ich das Lenkrad herumriss, schleuderte das Auto regelrecht um die eigene Achse.
Dann kam eine weitere Überraschung, dieses Mal zum Glück eine positive. In einiger Entfernung waren Blaulichter zu sehen, die sich schnell in meine Richtung bewegten. Da kam Hilfe! Welcher Grund auch immer sie herführte – sie würden helfen können. Vielleicht sollte ich Zeichen machen, damit sie nicht am Ende irgendwo abbogen, und mich deshalb gar nicht erst erreichten. Aber ich hatte keine Abzweigung gesehen, als ich gekommen war. Kurzerhand stellte ich den Motor wieder ab, und stieg aus. Den Regen bemerkte ich jetzt kaum mehr, obwohl er mit gleicher Intensität niederprasselte. Meine Erleichterung war einfach zu groß. Ich stellte mich breitbeinig hin und fing an, wild mit beiden Händen zu winken.
Der erste Polizist schälte sich aus dem Einsatzwagen, noch bevor er richtig angehalten hatte.
„Kommen Sie schnell“, rief ich ihm zu. „Da hinten liegt ein Mann, der dringend Hilfe braucht.“ Dabei deutete ich mit dem Daumen hinter mich.
„Haben Sie angerufen?“, fragte eine feste, klare Stimme. Das Gesicht, das zu der Stimme gehörte, konnte ich nicht erkennen, da ich plötzlich von einer Taschenlampe geblendet wurde.
„Nein, ich habe nicht angerufen. Aber da hinten liegt jemand, und ich glaube, er ist schwer verletzt! Sie müssen über Funk einen Krankenwagen rufen.“
Jetzt war ein zweiter Mann hinzugekommen. Er drehte sich sofort wieder um und verschwand im Polizeiwagen. Ich vermutete, dass er den Krankenwagen rief.
Eine Taschenlampe wurde mir gereicht. „Hier, gehen Sie vor.“
Mit dem Lichtkegel der Lampe vor mir fiel es mir wesentlich leichter, durch den Sumpf zu stapfen. Dafür war es umso schwieriger, Stefan anzusehen. Er sah entsetzlich aus. Die Schädeldecke war in der Mitte gespalten. Die unbeweglichen Augen schienen mir stumm den Vorwurf zuzuschreien, dass ich nicht rechtzeitig gekommen war.
Jetzt konnte ich mich dem Offensichtlichen nicht mehr verschließen. Vielleicht hatte ich es vorher schon gewusst, vielleicht hatte ich es nur nicht wahrhaben wollen. Die enorme Verletzung konnte unmöglich von einem normalen Sturz herrühren. Dies war kein Unfall gewesen. Verdammt!